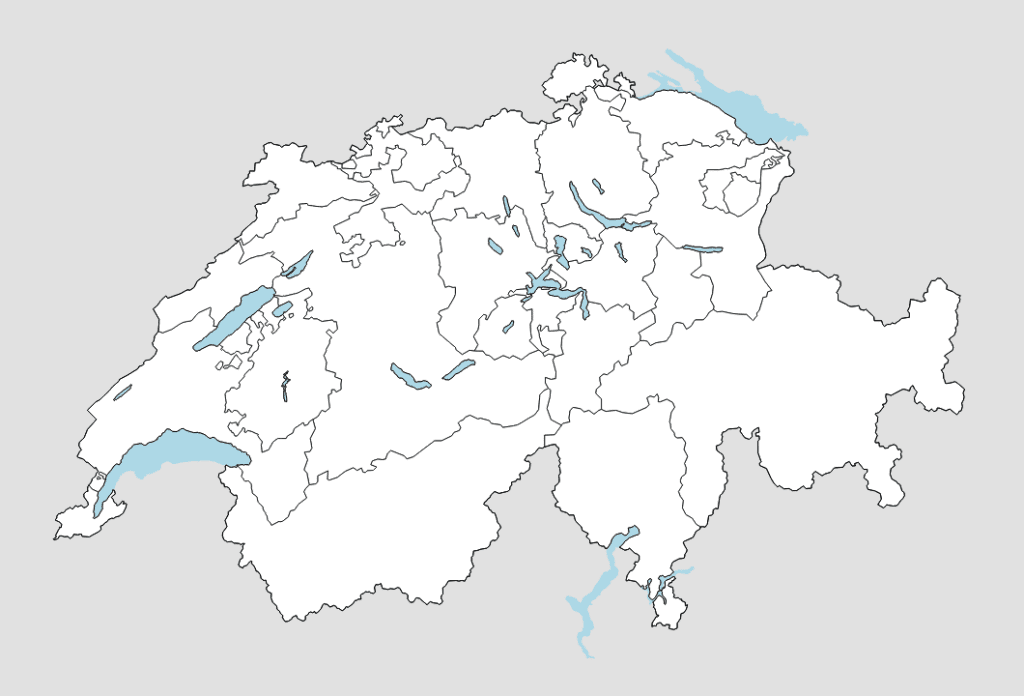Zum Beispiel in einem am Samstag vom «Blick» publizierten Chat-Protokoll, in dem Nationalrätinnen und Nationalräte aus der aussenpolitischen Kommission mit dem Wirtschaftslobbyisten und CDU-Europaabgeordneten Andreas Schwab kungeln – Schwab ist als Leiter der Schweiz-Delegation im EU-Parlament die Speerspitze der harten EU-Position gegen den Schweizer Lohnschutz. Oder in den Texten jener, die den Entscheid vom letzten Mittwoch zum Sieg der SVP aufblasen, obschon die SVP, erst wenige Monate ist es her, ihre Initiative gegen die Personenfreizügigkeit mit der EU spektakulär verloren hatte (wie vorher schon die Anti-Menschenrechts-Initiative und die sogenannte Durchsetzungsinitiative). Gewonnen hatte diese Schlüsselabstimmung eine starke Allianz der proeuropäischen Kräfte. Was der Bundesrat am letzten Mittwoch entschieden hat, liegt in der Logik von Aufträgen des Parlaments aus dem Jahr 2019: Der Lohnschutz muss auf dem heutigen Stand sichergestellt und nach Bedarf weiterentwickelt werden können. Wenn das mit dem Rahmenabkommen nicht möglich ist, hat dieses keine Perspektive.
In Zeiten der Verwirrung lohnt es sich immerhin, etwas weiter zurückzublenden. Nach dem Fiasko des EWR (1992) waren die bilateralen Verträge (1998-2000) im Verhältnis zur EU ein Durchbruch. Kernvertrag der Bilateralen ist die Personenfreizügigkeit. Entscheidend für die Zustimmung in der Volksabstimmung waren neue Massnahmen zum Schutz der Löhne, die in der Schweiz zuvor undenkbar waren. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hatte sie am Davoser Kongress 1998 als Bedingung dafür, die Bilateralen mitzutragen, gefordert («Nein, wenn nicht»). Auch damals hatten die Wirtschaftsverbände, die bürgerlichen Parteien und der Bundesrat keine Freude an den neuen Regeln, zumal sie der in den 90er-Jahren auch in der Schweiz anrollenden Welle von Deregulierung und Liberalisierung diametral widersprachen (und die rot-grüne Regierung in Deutschland sich gleichzeitig daran machte, die Lohnregeln aufzuweichen und einen Tieflohnsektor zu forcieren). Die staatstragenden bürgerlichen Kräfte akzeptierten den neuen Lohnschutz aber mit Blick auf die Volksabstimmung. Das Rezept «wirtschaftliche Öffnung verbunden mit sozialem Schutz» war erfolgreich. Damals, im Jahr 2000, wie auch später bei den verschiedenen Erweiterungsrunden der Bilateralen.
Wichtig ist: Der neue schweizerische Lohnschutz war und ist nichtdiskriminierend ausgestaltet, so wie es das Abkommen über die Personenfreizügigkeit (FZA) verlangt. Er fand und findet auf Arbeitnehmende aus der EU genauso Anwendung wie auf Schweizer Lohnabhängige. Keine EU-Instanz hatte damals gegen den schweizerischen Lohnschutz etwas einzuwenden.
Später änderte sich das. Nicht in der Schweiz, aber in der EU. 2006 wurde mit der Bolkestein-Richtlinie, benannt nach dem neoliberalen holländischen EU-Kommissar Bolkestein, die Priorität der Dienstleistungsfreiheit verankert. 2008 folgte der Europäische Gerichtshof mit Urteilen, die zur Förderung der Dienstleistungsfreiheit bei Entsendungen (Firmen, die in einem anderen Land Arbeiten verrichten) neu die Arbeitsbedingungen des Herkunftslandes als massgebend erklärten. Das aber ist exakt das Gegenteil von dem, was der schweizerische Lohnschutz verlangt: Massgebend sind, wenn in der Schweiz gearbeitet wird, die Arbeitsbedingungen in der Schweiz, also nicht jene im Herkunftsland, sondern vor Ort. Denn die Menschen leben von den Löhnen vor Ort. In der Schweiz von Schweizer Löhnen.
Seit dieser Zeit kritisiert die EU-Kommission den Schweizer Lohnschutz. Weil für sie die Geschäftsmöglichkeiten für Entsendefirmen aus der EU vor den Löhnen und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmenden rangieren. Deshalb stören die wirksamen Lohnkontrollen in der Schweiz die EU-Kommission. Zugespitzt: Für die EU-Kommission sind die Gewinnmöglichkeiten der Entsendefirmen, auch wenn sie Regeln brechen, wichtiger als der Lohnschutz für die Lohnabhängigen. Das ist der Kern des Konflikts. Die Gewerkschaften aber können und werden eine Schwächung des Lohnschutzes nie akzeptieren. Für die Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen geht es um vitale Interessen.
Es geht dabei nicht nur um eine schweizerische, sondern auch um eine europäische Auseinandersetzung. Oder anders formuliert: Es geht um eine soziale, nicht eine nationale Frage. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat den Grundsatz «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» in den Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) eingebracht, dessen Mitglied er ist. Die europäischen Gewerkschaften vertreten in diesen Fragen exakt die gleichen Positionen wie die schweizerischen. Auf Initiative des EGB ist der Grundsatz inzwischen auch auf europäischer Ebene allgemein anerkannt.
Was für den Grundsatz gilt, gilt leider nicht für die Instrumente zu seiner Durchsetzung. Jeder Grundsatz aber ist nur und genau so viel wert wie seine Durchsetzung. Ohne wirksame Instrumente taugen die schönsten Programme nichts.
Auf diesem Hintergrund zeigt sich, was bei den Verhandlungen über das Rahmenabkommen schiefgelaufen ist. Im Juni 2018 signalisierte der damalige Chefunterhändler der Schweiz, Roberto Balzaretti, der EU die Bereitschaft, beim Lohnschutz nachzugeben, dies gegen die «roten Linien» des Bundesrats. In seinem Gefolge stellten die beiden FDP-Bundesräte die flankierenden Massnahmen öffentlich in Frage. Der Bundesrat bekräftigte nach dem Protest der Gewerkschaften den Lohnschutz als «rote Linie». Trotzdem verhandelte Balzaretti gegen das Mandat weiter. Einen derartigen Vertrag aber konnte der Bundesrat nicht akzeptieren.
Kein Wunder, lobt der EU-Abgeordnete und Wirtschaftslobbyist Andreas Schwab Balzaretti in dem vom «Blick» publizierten Chat jetzt über den grünen Klee als «Topmann», hat dieser doch als Chefunterhändler der Schweiz beim Lohnschutz die Positionen der EU-Kommission übernommen und den Kampf gegen die schweizerischen Gewerkschaften eröffnet, statt sich an die vom Bundesrat definierten «roten Linien» zu halten. Mit einer solchen Verhandlungsführung muss man sich auch nicht wundern, dass die EU-Kommission bei diesem Thema hart blieb und sich in der Folge nicht mehr bewegte. Dies umso mehr, als die Position der EU-Kommission beim Lohnschutz in vielen Medien auch hierzulande kritiklos übernommen wurde. Damit war der Absturz des Projektes vorprogrammiert.
Das Fazit: Die neoliberalen Feinde des Lohnschutzes in der EU und in der Schweiz sind zwar imstande, sich über die Köpfe der Betroffenen hinweg zu einigen. Politisch zum Fliegen kommt das Resultat dennoch nicht. Und sicher nicht in einer direkten Demokratie, in der die sozialen Interessen nicht straflos ausgeblendet werden können.
Wie geht es weiter? Die Zukunft ist nie vorhersehbar. Ein paar Überlegungen mögen immerhin weiterhelfen.
Wesentlich ist zunächst, dass die heutigen Verträge weiterlaufen und gelten. Daran ändert sich nichts, wenn der Bundesrat unzumutbare Vorschläge der EU-Kommission nicht übernommen und unterschrieben hat. Wer jetzt Schikanen und Drohkulissen an die Wand malt, hat nicht verstanden, dass es das A und O jeder Beziehung ist, sich an die vereinbarten Regeln zu halten. Das gilt auf Gegenseitigkeit.
Sodann ist nicht nur die Schweiz, sondern auch die EU in ständiger Bewegung. Die vielen Wendungen des EU-Projekts in seiner Geschichte hat jüngst Perry Anderson in einem aufschlussreichen Text in der Kulturzeitschrift Lettre International dargestellt («Operation Europa», erschienen in Lettre International Nr. 132 Frühjahr 2021). Was die Forderungen der EU-Kommission gegenüber der Schweiz zum Lohnschutz betrifft, so wurde diese 2019 im Europäischen Parlament nur noch mit knapper Mehrheit gestützt (330 zu 302 Stimmen).
In der EU spielen in diesen Fragen erfahrungsgemäss ohnehin Deutsche eine entscheidende Rolle. Falls die Grünen im kommenden Herbst die deutschen Wahlen gewinnen, dann kann sich in diesen Fragen in den nächsten Jahren alles ändern. Definiert werden die Positionen dann möglicherweise nicht mehr von gewerkschaftsfeindlichen Hardlinern wie Andreas Schwab, sondern von Kräften, die der sozialen Frage eine andere Bedeutung beimessen. Wem nicht entgangen ist, dass die EU ihre Haltung während der letzten Monate bedingt durch die Coronakrise in wirtschaftlich viel bedeutenderen Fragen wie jener der Staatsinterventionen fundamental revidiert hat, der sollte mitberücksichtigen, dass die kommenden Jahre Risiken, aber auch Spielräume bringen. Die insgesamt gut funktionierenden Verträge mit der Schweiz sind aus EU-Sicht jedenfalls eines der kleineren Probleme.
Überhaupt spricht vieles dafür, dass nicht nur die ökologischen, sondern auch die sozialen Anliegen in Zukunft wieder einen grösseren Stellenwert bekommen werden und müssen. Dies gilt für die EU wie für die Schweiz. Die Entwicklung in den USA ist jedenfalls ein Fingerzeig in diese Richtung.
Auf internationaler Ebene entwickelt sich insbesondere die Steuerpolitik über die OECD in eine interessante Richtung, der sich auch die Schweiz nicht entziehen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass nach Jahren endlich wieder Möglichkeiten für mehr Steuergerechtigkeit entstehen.
Die Linke hat jedenfalls die Aufgabe, die sozialen Interessen zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Einer wachen Linken, die sich nicht überschätzt, aber vor allem auch nicht unterschätzt, stehen interessante Zeiten bevor. Für eine weltoffene Schweiz, mental und real, war und bleibt die Linke entscheidend. Wenn sie in der Lage ist, die sozialen Interessen wirksam und glaubwürdig zu vertreten.